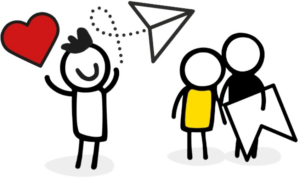Politische Themen im Klassenzimmer diskutieren – verboten oder nicht? Über ein für Schulen vermeintlich geltendes Gebot der Neutralität versuchen rechte Influencer*innen und Parteien, die kritische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im Unterricht zu verhindern …
Was kann die Schule tun? Wie können Lehrkräfte ihrem Bildungsauftrag zur Demokratieerziehung nachkommen? Das BgR klärt auf: Wir bieten Infomaterial und Kurzvorträge für Ihre Konferenz, Eltern- und Schüler*innenveranstaltung.
Politische Themen im Klassenzimmer diskutieren – verboten oder nicht? Über ein für Schulen vermeintlich geltendes Gebot der Neutralität versuchen rechte Influencer*innen und Parteien, die kritische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im Unterricht zu verhindern. Dabei müssen Lehrkräfte gar nicht politisch neutral sein – im Gegenteil: Demokratieerziehung ist ein zentraler Bestandteil des staatlichen Bildungsauftrags.
Meldeportale, Kleine Anfragen oder gezielte Kampagnen – durch zunehmenden Druck durch soziale Medien, Lokalpolitik und auch Elternhäuser sind viele Lehrkräfte verunsichert und trauen sich nicht mehr, ihrer demokratischen Aufgabe gerecht zu werden. Doch es steht die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Menschenrechten und Meinungsfreiheit im Schulgesetz. Deshalb dürfen sich Pädagog*innen, wenn es in der Schule um politische Konflikte geht, gar nicht neutral verhalten:
- Zeigen Sie eine klare Haltung gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und Gewaltverherrlichung.
- Schützen Sie Ihre Schüler*innen, die von Diskriminierung und/oder rechtsextremen Ideologien betroffen sind.
- Beleuchten Sie bei schwierigen Themen unterschiedliche Perspektiven sowie konkrete politische Aussagen und Vorgänge.
- Und last, but not least: Die AfD ist bundesweit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das dürfen und sollen Sie im Klassenraum auch sagen.
Mit Kurzvorträgen zum Mythos »Neutralitätsgebot« an Schulen bieten wir als BgR Weimar einen Einstieg in das Thema und unterstützen Sie – als Pädagog*innen, aber auch interessierte und engagierte Schüler*innen und Elternvertretungen – für Pluralismus und Demokratiebildung an Ihrer Schule einzutreten.
In den etwa 20-minütigen Inputs klären wir u.a. diese Fragen
- »Neutralitätsgebot« – was bedeutet das?
- Wie politisch neutral müssen Pädagog*innen sein?
- Gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit?
- Was sagen die Gesetze?
- Wo kann ich mich beraten lassen
Unsere kostenlosen Vorträge können Sie ergänzend z.B. für Ihre Konferenz oder Schulveranstaltung buchen.
Begleitend gibt es aktuelle Beiträge auf unseren Social Media Accounts bei Instagram und Facebook. Weiterführende Literatur und Beratungsstellen in Thüringen finden Sie in der Randspalte bzw. am Ende dieser Seite.
Was bedeutet Neutralität?
Generell gilt die Schule als politisch neutraler Raum. Für Parteien u. Ä. darf nicht geworben werden, auch nicht durch Auslegen von Wahlkampfmaterialien. Gleiches gilt für Unterschriftensammlungen.
Pädagog*innen müssen nicht politisch neutral sein. Ihre durch Grundgesetz und Landesschulgesetze festgelegte Aufgabe ist es, Schüler*innen demokratische Werte wie Menschenrechte, Toleranz, Meinungsfreiheit und politische Partizipation zu vermitteln.
Wie dürfen und müssen Sie sich als Pädagog*innen positionieren?
Die Förderung des eigenständigen Lernens und des eigenverantwortlichen Handelns und die Vermittlung von Werten auf Grundlage des § 2 (1) des Schulgesetzes sind Pflicht aller Lehrkräfte:
Wesentliche Ziele der Schule sind […] die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung […].
Lehrer*innen dürfen selbstverständlich die eigene Meinung äußern. Sie müssen ebenso selbstverständlich dafür sorgen, dass die Meinungen der Schüler*innen zur Geltung kommen und diese nicht einseitig beeinflusst werden.
Was spricht gegen Neutralität?
Eine strikte Neutralität würde wichtige Diskussionen verhindern und die Bildung der Schüler*innen beeinträchtigen. Die Aufgabe von Lehrkräften ist, demokratische Werte zu vermitteln, um Schüler*innen auf eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft vorzubereiten. Kontroversität ist dabei wichtig, jedoch dürfen undemokratische Haltungen nicht mit demokratischen gleichgestellt werden.